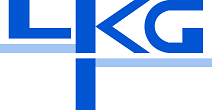I.
Die Bedeutung von Ostern
Der Ostergruß: „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden“ ist die Botschaft an Ostern. Was bedeutet diese Botschaft? Was ist die Bedeutung der Auferstehung Jesu?
1.
Die Bibel nennt drei zusammenhängende Bedeutungsebenen:
(1) Die Bestätigung Jesu durch Gott
(2) Der Sieg über alle tödlichen Lebensmächte: Sünde, Teufel und Tod
(3) Der Anfang der neuen Schöpfung
2.
Ich will im ersten Teil meiner Predigt uns die dritte Bedeutungsebene vorstellen. Dazu werfen wir drei kurze Blicke in die Bibel.
(1)
Blick 1: Die Auferstehung Jesu geschah an einem Morgen, am Anfang eines neuen Tages. Das ist kein Zufall! Dahinter steht eine Absicht Gottes. Damit will er uns auf etwas aufmerksam machen.
„Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche“ (Mk 16,9)
„Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach (Mt 28,1)
„Aber am ersten Tag der Woche sehr früh (Luk 24,1)
„Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war (Joh 20,1)
(2)
Blick 2: Das Neue Testament betont, dass die Auferstehung ein Startschuss war. Es hat am Ostermorgen etwas Neues begonnen (auch wenn es schon lange vorher im AT angekündigt war).
Jesus ist der «Erstgeborene unter vielen Brüdern» (Röm 8,29) bzw. der «Erstgeborene von den Toten» (Offb 1,5), der «Erstling der Entschlafenen» (1Kor 15,20). Und in Apg 3,15 wird Jesus wörtlich der «Anfang oder Fürst des Lebens» genannt.
(3)
Blick 3: Wir schauen noch einmal in die Bibel. Es gibt eine schöne Parallele zwischen Alten und Neuen Testament, zwischen der Schöpfungserzählung am Anfang der Bibel und dem Ostermorgen:
a.
Die Schöpfung beginnt mit einem Garten. Ostern beginnt in einem Garten.
b.
In der biblischen Schöpfungserzählung heißt es in 1 Mo 2,7: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. – Und in Joh 20,22 heißt es: Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den heiligen Geist.
2.
Wir halten das Ergebnis fest: Die Auferstehung Jesu war der Neubeginn, der erste Tag der neuen Schöpfung. Ostern war und ist der Anfang der Heilung der Welt, der Erneuerung aller Dinge, der Anfang der großen Heilszeit. Das feiern wir an Ostern! Halleluja!
Ostern hat der Welt eine Hoffnung eingepflanzt! Die leibliche Auferstehung Jesu ist nicht weniger als die Hoffnungsgewissheit auf die totale Veränderung der Welt, auf die totale Veränderung allen Lebens, auf die totale Veränderung unseres Lebens. Das ist eine Veränderung nicht nur zum Besseren, sondern zum Besten. Eine erlöste Welt, die befreit ist von allen Gestalten des Bösen, befreit von allen Handlangern des Todes, befreit von allen Kriegen und aller Gewalt, befreit von allen Krankheiten und Nöten unseres jetzigen Lebens.
II.
Die Gründe für den christlichen Auferstehungsglauben
Ich lese den Predigttext Joh 20,11-18:
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!
17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.
1.
Christlicher Glaube, österlicher Glaube ist begründeter Glaube.
Alle Auferstehungserzählungen vom Ostermorgen nennen drei Gründe für die Auferstehung:
(1) Das leere Grab.
(2) Besondere Erfahrungen mit dem Himmel, mit der jenseitigen Welt.
(3) Die Geschichten über Begegnungen mit dem Auferstandenen, die zur eigenen Begegnung mit dem Auferstandenen werden.
Die ersten zwei Gründe, das leere Grab und die Erfahrungen mit der himmlischen Welt, sind Vorarbeiter und Wegbereiter. Sie sind Entwicklungs- und Entdeckungshelfer. Sie sind nicht unwichtig. Aber sie sind keine hinreichenden Gründe. Sie vermögen es nicht, dass Glaube an die Auferstehung bzw. an den Auferstandenen entsteht.
Der dritte Grund, die Begegnung mit dem Auferstandenen, ist der Hauptgrund. Osterglaube entstand am Ostermorgen und entsteht bis heute immer durch die Begegnung mit dem Auferstandenen.
2.
Deshalb wollen wir uns heute Morgen die Begegnung Jesu mit Maria Magdalena näher anschauen. Diese Geschichte kann uns sehr helfen.
(1)
Marias Irrtum Nr. 1
a.
Maria ist umgetrieben von ihrer Trauer und von ihrer Liebe zu Jesus. Maria weint (4x wird das erwähnt). Es sind Tränen des Verlustes, des Schmerzes. Alle, auf die sie trifft, fragt sie nach Jesus.
b.
Die Tatsache des leeren Grabes führt sie nicht zum Glauben. Das leere Grab ist für Maria ein Problem. Sie denkt: Jetzt habe ich nicht einmal einen Ort zum Trauern.
c.
Auch die Begegnung mit der himmlischen Welt vermittelt Maria keinen Glauben. Die beiden Engel fassen die Leerstelle ein, die Jesus hinterlassen hat. Es war damals so, es ist heute so: Erfahrungen mit dem Jenseits ohne Jesus schaffen keinen Auferstehungsglauben.
Dennoch: Die Frage der Engel: Was weinst du?, ist eine positive Überraschung und eine erste Hilfe. Die Engel fragen nicht, weil sie die Antwort nicht wüssten. Die Frage soll Maria weiterhelfen. Maria schüttet ihr Herz aus: Irgendwer hat den Leichnam meines Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.
d.
Maria bemerkt die Gegenwart Jesu. Sie wendet sich ein erstes Mal Jesus zu, ohne zu begreifen, dass es Jesus ist. Maria steht hier für alle Menschen, die im Blick auf Jesus einem Irrtum unterliegen. Man hält Jesus für jemanden anderen. Maria hält Jesus für den Gärtner. Heute halten Menschen Jesus für einen besonderen Menschen der Vergangenheit oder für jemanden, der sie ködern, im letzten aber einschränken will. Maria macht also die die Erfahrung, die seitdem Millionen von Menschen gemacht haben: Jesus ist unbemerkt, aber unerkannt da.
e.
Jesus will Maria von ihrem Irrtum befreien. Deshalb stellt er ihr zwei Fragen.
Die erste Frage ist dieselbe Frage, die die Engel stellten, übrigens auch die dieselbe, die Jesus denen stellte, die ihn verhafteten: Was weinst du? Warum weinst du? Wie gesagt: Jesus weiß die Antwort. Maria muss diese Frage durchdenken. Gibt es einen Grund zum Weinen? Ist mein Weinen begründet? Es gibt ja viele Gründe zum Weinen. Aber in diesem Fall gibt es keinen Grund! Das ist der Clou dieser Begegnung!
Die Frage wird zur offenen Tür für Maria. Maria ist der erste Menschen, der eine wesentliche Erkenntnis über Jesus geschenkt bekommt: Kein Mensch muss um Jesus weinen! Kein Mensch muss über den toten Jesus weinen!
Die zweite Frage vertieft die erste Frage: Wen suchst du? Den toten Jesus? Auch diese Frage wird zur offenen Tür für Maria. Maria ist noch einmal der erste Mensch, der etwas sehr Wesentliches über Jesus begreifen darf: Kein Mensch muss den toten Jesus suchen. Den gibt es nämlich nicht! Jeder Mensch darf den auferstandenen, lebenden Jesus entdecken, der da ist, der uns sucht, der uns hilfreiche Fragen stellt.
Jesu Doppelfrage ist Evangelium pur! Der Himmel sagte Maria damals und sagt uns heute Morgen: Nichts und niemand kann dir Jesus wegnehmen. Du musst nicht auf ihn verzichten. Du musst dir um Jesus keine Sorgen machen. Du musst um ihn keine Angst haben. Auch vor ihm nicht.
f.
Dann gibt sich Jesus Maria zu erkennen, indem er ihr zeigt, dass er sie kennt. Er macht das, indem er Maria mit ihrem Namen entspricht. Jesus redet aramäisch. Er verwendet das vertraute, intime Mariam. Das ist, wie wenn zwei sich liebende Menschen sich mit ihrem Kosenamen ansprechen.
Maria/Mariam hatte sich schon einmal, aber nur kurz Jesus zugewandt. Wollte sie ihre Tränen verbergen? Gut möglich! Warum sollte sie einem für sie fremden Mann ihre Tränen und ihr Inneres zeigen? Jetzt wendet sie sich ein zweites Mal um. Sie ist der erste Menschen, die sich Jesus zuwendet, also dem Auferstandenen, der da ist und der sich uns zuwendet. Sie antwortet – ebenfalls auf Aramäisch: Rabbuni! Es ist eine Anrede des Vertrauens und der Ehrfurcht. In diesen beiden hebräischen bzw. aramäischen Wörtern liegt die gemeinsame Geschichte zwischen den beiden. Diese beiden Wörter stehen für ihre Nähe und Vertrautheit und Liebe.
(2)
Marias Irrtum Nr. 2
Maria will in die Arme oder Jesus zu Füßen fallen. Sie will ihn berühren. Maria unterliegt einem zweiten verständlichen Irrtum. Für sie ist die Auferstehung eine Rückkehr aus dem Tod ins normale Leben. Maria muss hier als erster Mensch lernen, was wir alle über die Auferstehung lernen müssen, dass nämlich Jesu Auferstehung viel mehr und etwas total anderes ist als die Rückkehr aus dem Tod ins normale Leben.
Jesu Auferstehung ist keine Wiederbelebung, sondern der Eintritt in die Art und Weise, wie Menschen in der Ewigkeit existieren werden. Jesus ist der Prototyp des neuen Menschen mit dem neuen geistlichen Körper.
Jesus kritisiert Maria nicht. Und doch korrigiert er ihren Irrtum mit einer unmissverständlichen Anweisung: Halte mich nicht fest! Die Übersetzung: „Rühre mich nicht an“ trifft den Sinn nicht. Jesus sagt: Maria, lass deinen Wunsch nach unserer bisherigen Art der Gemeinschaft los. Die Art und Weise, wie wir in Zukunft zusammen sind, ist nicht mehr die irdische, menschliche, sichtbare und körperliche.
Maria erleidet damit auf der einen Seite das Ende von allem, was ihr vertraut war und was sie geliebt hat. Aber dieses Ende ist ein Anfang. Der äußerliche Abschied von Jesus und seinem irdischen Wirken wird zur Tür für ein ganz neues, intensiveres Miteinander mit Jesus und mit Gott. Jesus spricht ja von „meinem Vater“ und „eurem Vater“.
Und wie „geschieht“ dieses neue, intensivere Miteinander? Es geht über den Glauben. Der Glaubende erfährt im Glaubensvollzug die Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott.
Dazu gleich mehr im dritten Teil der Predigt. Zunächst werten wir die Begegnung Jesu mit Maria aus!
3.
„Wie wenig Lärm machen die wirklichen Wunder! Wie einfach sind die wesentlichen Ereignisse!“ Ich mag diese Spruchweisheit von Antoine de Saint Exupéry.
Dieses leise Wunder am Ostermorgen zwischen Jesus und Maria geschieht immer, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Es ist das Wunder der Nähe Jesu, der Lebendigkeit Jesu, des Redens Jesu. Denn es gilt: Wer da ist und redet, kann nicht tot sein. Es geschah am Morgen der Auferstehung, was seitdem immer geschieht, wenn ein Menschen zum Glauben an Jesus kommt. Der Glaube kommt über das Hören, wenn Jesus redet.
Es ist die Entdeckung, dass meine ganze Geschichte, ja dass ich selbst von ihm tiefen-erkannt ist. Es ist die Erfahrung, gewollt und geliebt zu sein.
Am Ostermorgen geschah ein Wunder, eine Konversion, ein Neuanfang. Es war der Moment, in dem Maria selbst auferstand. Wie gesagt: Über das Hören eines Wortes von Jesus kommt es zum Osterglauben. Osterglaube hat ein Zeugnis mit wenig Lärm: „Du rufst mich. Also lebst du. Und mit Dir und durch Dich auch ich!“
Damit sind wir nun beim angekündigten dritten Teil der Predigt.
III.
Teil 3: Unsere Beteiligung an der Auferstehung
Die Geschichte von der Begegnung mit Maria ist eine Tür, eine offene Tür. Wir können uns in diese Geschichte einlesen.
1.
Wir können aus den Irrtümern der Maria lernen
Maria suchte den toten Jesus. Sie fand ihn nicht. Weil es den toten Jesus nicht gibt. Der Auferstandene aber suchte und fand sie. Maria dachte, ihre Beziehung zu Jesus ist vorbei. Nein, sie fing erst an.
Maria dachte, sie müsse um Jesus trauern. Nein, das musste sie nicht. Das müssen wir nicht. Wir haben viele Gründe zum Sorgen und Trauern. Aber um Gott müssen wir uns keine Gedanken oder Sorgen machen! Das ist so unendlich befreiend und hoffnungsvoll.
2.
Diese Geschichte ist eine offene Tür. Der Auferstandene tritt aus ihr heraus und spricht uns mit unseren Namen an.
Ich lade Sie zu einer Übung ein. Stellen Sie sich vor. Jesus ist da. Er spricht Sie mit ihrem Namen, mit ihrem Spitznamen, mit ihrem Kose-Namen an.
3.
Wir können uns wie Maria Jesus zuwenden. Einmal. Zweimal. Immer wieder.
a.
Wenn Sie das noch nie gemacht haben, können Sie es sich überlegen. Der Predigttext und die Predigt von Thomas Pichel behaupten: Der Auferstandene lebt. Er ist da. Er kennt mich. Vielleicht haben Sie den Wunsch, sich umzudrehen? Weg von dem, was Sie bis jetzt gedacht haben. Hin zu Jesus.
Dazu ein Gedanke: Was ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen? Christen wissen besser um ihre gemeinsame Geschichte mit Gott. Nichtchristen wissen das oft nicht.
b.
Wenn Sie gläubig sind und eine Geschichte mit Jesus haben (wie Maria), dann könnte dieses Umdrehen der Maria für sie dran sein, wo sie vielleicht, ohne es zu bemerken, Jesus ihre Tränen oder ihre Sorgen oder ihre Wut oder ihre Bitterkeit… verborgen haben.
Vertrauen Sie der Botschaft von Joh 20,11-18: Wir müssen nichts vor ihm verbergen. Ihm können wir uns zeigen und anvertrauen.
c.
Wir dürfen wie Maria Jesus mit Rabbuni ansprechen. Das heißt übersetzt „Lehrer“ und „Meister“. Ich übertrage jetzt die zweite Bedeutung auf unser Leben.
Maria sagt: Mein Meister. D.h. für uns das, was es für Maria damals hieß: Jesus meistert mein Leben, nicht ich! Jesus meistert meine Situation! Jesus meistert mein Sterben! Gottseidank! Halleluja!